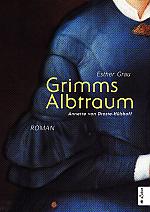„Viel Glück zum neuen Jahre, mein altes Lies! Das vergangene ist nicht eben zu loben, Ihnen hat es viele äußere und innere Stürme gebracht, mir eine lange Krankheit und doch auch manche Erschütterung, und so steht’s mit fast allen, die uns nahe sind. Möge das begonnene friedlicher sein! Und um ihm den möglichst vorteilhaften Anstoß zu geben, fange ich es mit einem Briefe an diejenige an, von deren Liebe ich seine besten und innigsten Momente erwarte. Nicht wahr, mein Lies? Treu bei Sonnenschein und Schnee, in guten und bösen Tagen? In Leiden uns auf den andern gestützt, die Freuden doppelt genossen, und wenn’s uns beiden schlecht gehn sollte, doch wenigstens noch einander gehabt! So wär’ es doch ein Wunder, wenn zwei so zähe Planken wie wir sich nicht leidlich über dem Wasser halten sollten! Wüßten die Egoisten, welcher große Frieden in der Treue liegt, sie bekehrten sich alle dazu. Treue kann ja nie schaden, selbst die verratene nicht, denn sie gibt ein gutes Gewissen, und somit das Beste, was irgend eine Zeit bringen kann.
Wir leben hier so ruhig voran, ohne sonderliche Abwechslung. Ich sitze wie eine Maus im Loche in meinem Turme und knuspere eine Nuß nach der andern aus Laßbergs Bibliothek, zuweilen mit recht harter saurer Schale, und auch der Kern erinnert mich oft an unsrer lieben Vorfahren rohe Eicheln, aber was tut man nicht der Ehre wegen! Droben geht’s derweil bunt zu, die gelehrten Besuche treten sich fast einander die Schuhe aus, wovon ich mir denn nachher bei Tische erzählen lasse und bis jetzt noch keinen Namen gehört habe, der es mir leid machte, dass ich nicht zur Hand war. Lauter Professoren X., Y. und Z.
Mir fehlt hier gar nichts wie Sie, aber Sie fehlen mir arg, und ich kann kaum ein Dampfboot aus meinem Fenster heranbrausen sehn, ohne in Gedanken nach meiner Lorgnette zu greifen, ob Sie vielleicht auf dem Verdecke stehn. Das alte Lied hat wohl Recht: “Oh, glaubt es mir, die Liebe, sie macht die Menschen dumm!” oder zerstreut vielmehr, löst die Seele vom Leibe und macht zweihundert Stunde[n] zu einem Katzensprung.
Wir haben jetzt Schnee, ich folglich Anlage zum Rheumathismus und habe seit vierzehn Tagen meine lieben Gänge am Strande aufgeben müssen, aber der See liegt unter meinem Fenster, und jeden Nachmittag sind Sie meine Fata Morgana. Altes Lies! Gott segne und erhalte Sie! […]
Ich habe doch jetzt grade die Abschrift meiner Gedichte fertig und wollte mich eben über das “Bei uns zu Lande” hermachen. Aber das kann warten; vorgestern, am Silvestertage, habe ich die letzte Zeile geschrieben und bis Mitternacht gearbeitet, weil es mir ominös schien, nicht mit dem Jahre zugleich abzuschließen. Ich hatte eben mein Tintefaß zugemacht und kleidete mich aus, als die Glocke schlug und unter lautem Hurra eine Gewehrsalve die neue Zeit ein- und mein Manuskript tot- oder ihm Viktoria schoß – was von beidem? Ich sehe dem Erfolg so ruhig entgegen, wie dies ohne Affektation möglich ist und befinde mich “den Umständen nach ganz wohl”.
Gestern verging unter Kirchengehn, Besuchen, Neujahr-Abgewinnen, kurz dem ganzen Einzugstrubel der neuen Epoche, und heute läuft wieder alles im alten Gleise, nur dass ich statt Gedichte Briefe schreibe und Laßberg statt seiner geliebten Pergamente mein Manuskript liest und, da der heutige Stil ihm ganz fremd geblieben ist, den Kopf öfter schüttelt als mir lieb ist. Ich fürchte nicht sein Mißfallen, aber seinen Rat; manche Leute empfinden einen mit einiger Überwindung gegebenen und dann vernachläßigten Rat fast so schlimm als eine Ohrfeige, und ich fürchte, Laßberg gehört zu diesen.
Im Ganzen hat er mich heute belobt, aber schon einige Abänderungen vorgeschlagen, die sehr sehr nach der alten Schule schmecken, und mir nebenbei Gellert als den vollkommensten deutschen Stilisten empfohlen. Sie sehn, wo das hinaus will! Es würde mir überaus leid sein, den ritterlichen alten Herrn zu kränken, aber in ganz veraltete Formen kann ich mich doch unmöglich zurückschrauben lassen und sehe somit dem Ende der Lektüre, wo, wie er sagt, wir “das Ganze gemeinschaftlich durchnehmen wollen”, mit großem Unbehagen entgegen.
Sie sehen, lieb Lies, anno 44 fängt bei mir mit einem Paar Stirnrunzeln an: entweder Verdruß im Hause, oder die Kritiker auf dem Nacken. Gott helfe mir durch Scilla und Charibdis!“
Brief aus Meersburg vom 2. Januar 1844 an Elise Rüdiger